Barrierefreiheit & § 3 Abs. 3 BFSG – Überblick
Kompakt erklärt: Rechtslage, Ausnahme, Praxis, Folgen und klare Empfehlungen.
Gesetzlicher Rahmen
Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) setzt in Deutschland die EU-Richtlinie 2019/882 um und regelt seit dem 28. Juni 2025 die Pflicht zur digitalen Barrierefreiheit für Produkte und Dienstleistungen. Ziel ist gleichberechtigter Zugang zu digitalen Angeboten.
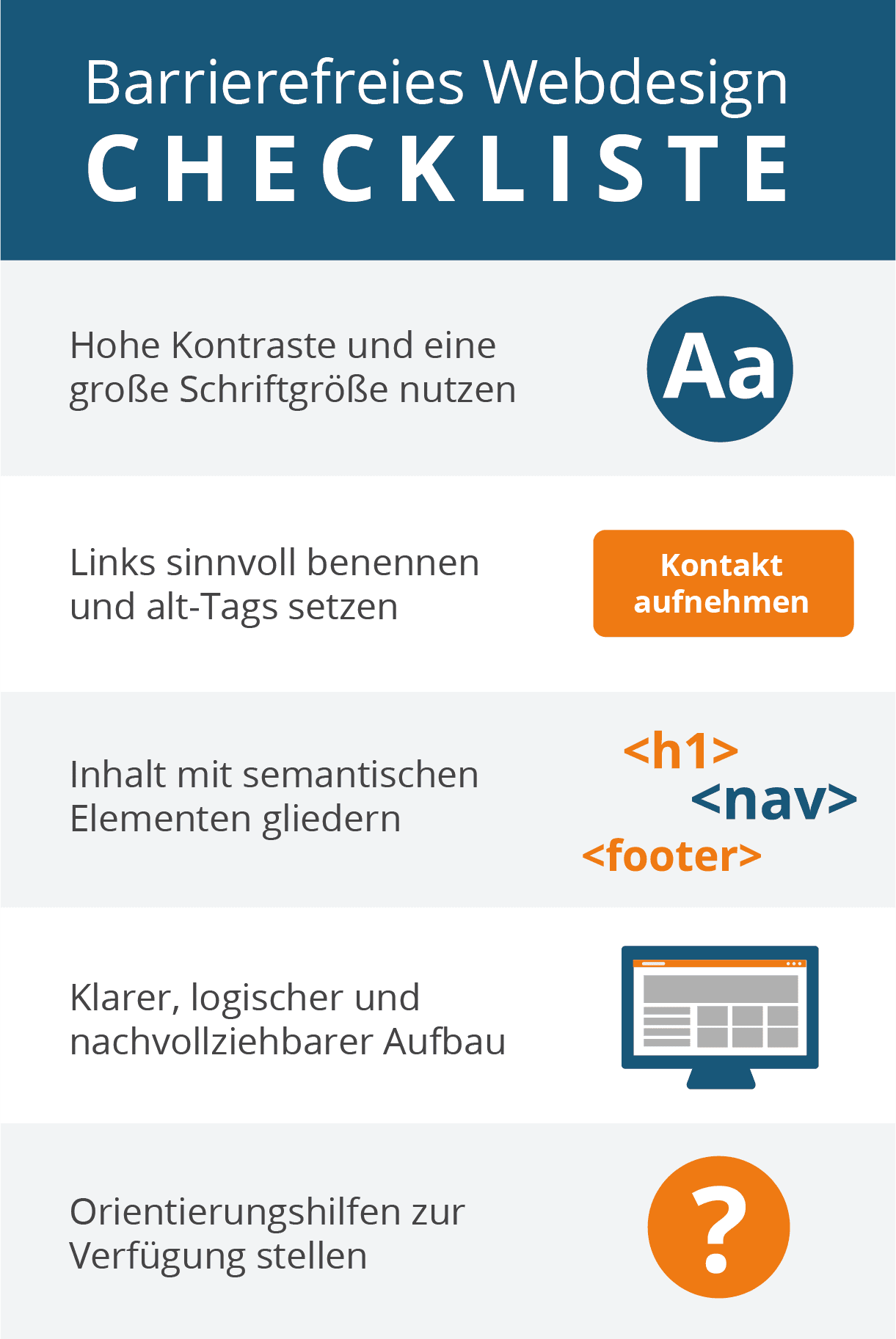
Die versteckte Ausnahmeregelung in § 3 Abs. 3 BFSG
„Kleinstunternehmen im Sinne von § 2 Nr. 17 sind… Unternehmen, die weniger als zehn Beschäftigte aufweisen und einen maximalen Jahresumsatz von 2 Millionen Euro bzw. eine Jahresbilanzsumme von 2 Millionen Euro nicht überschreiten.“
Konkret: Solo-Selbstständige, Freiberufler und Kleinstbetriebe mit < 10 Mitarbeitenden und ≤ 2 Mio. € Umsatz oder Bilanzsumme sind von der Pflicht zur Bereitstellung barrierefreier digitaler Dienstleistungen ausgenommen.
Praxis: Wie Anbieter den Haken verschweigen
- Werbung mit Full-Service-Barrierefreiheit ohne Hinweis auf die Ausnahme für Kleinstunternehmen.
- Ausführliche Leistungs- und Preisübersichten, aber kaum Hinweise auf 10 MA / 2 Mio. €-Schwellenwerte.
- In Verkaufsgesprächen wird eine universelle Pflicht suggeriert, um Abschlussdruck aufzubauen.
Folgen für kleine Unternehmen
- Überschüssige Kosten: Tausende Euro für Prüfungen, Anpassungen und Wartung trotz Befreiung.
- Wettbewerbsnachteile: Schlechtere Kostenposition gegenüber informierten Mitbewerbern.
- Mangelndes Vertrauen: Intransparenz schwächt Vertrauen in Anbieter und Regelungen.
Handlungsempfehlungen
- Gesetzestext lesen: § 3 Abs. 3 BFSG genau prüfen („Gesetze im Internet“).
- Ausnahme dokumentieren: Kleinststatus regelmäßig (z. B. im Impressum) vermerken.
- Transparente Dienstleister wählen: Angebote vergleichen, nach Schwellenwerten fragen.
Fazit
Der „Betrug“ liegt weniger im Gesetz, sondern in fehlender Transparenz. Die Ausnahme des § 3 Abs. 3 BFSG ist klar geregelt, wird jedoch selten offen kommuniziert – das führt zu unnötigen Kosten und Verunsicherung. Wer die Bestimmungen kennt, schafft Rechtssicherheit und spart Budget.
Weitere Artikel
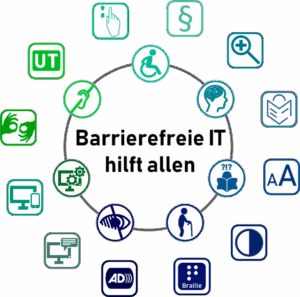
Der „Betrug“ mit der Barrierefreiheit – verborgen hinter § 3 Abs. 3 BFSG
Barrierefreiheit & § 3 Abs. 3 BFSG – Überblick Kompakt erklärt: Rechtslage, Ausnahme, Praxis, Folgen und klare Empfehlungen. Gesetzlicher Rahmen Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) setzt in

Eine erfolgreiche Webseite erstellen – Worauf du achten solltest
Deine erfolgreiche Website – Schritt für Schritt Von der Planung über Design & SEO bis zur Wartung – alles, was du für eine professionelle Website
Warum man nicht jedem Freelancer oder Virtuellen Assistenten vertrauen sollte – Das schöne Profilbild trügt
Freelancer & Virtuelle Assistenten – Warum ein sympathisches Profilbild nicht reicht Wie du echte Kompetenz erkennst und teure Fehlentscheidungen vermeidest. In der heutigen digitalen Welt
